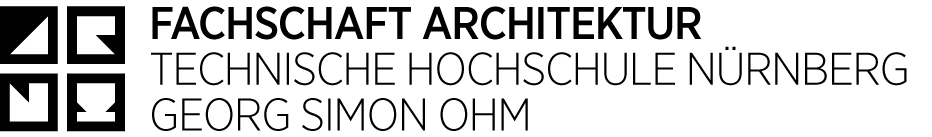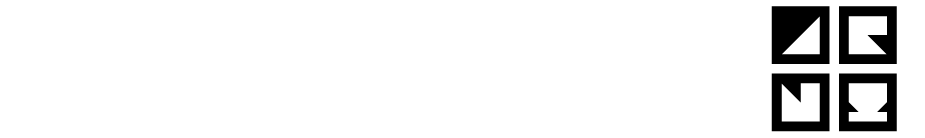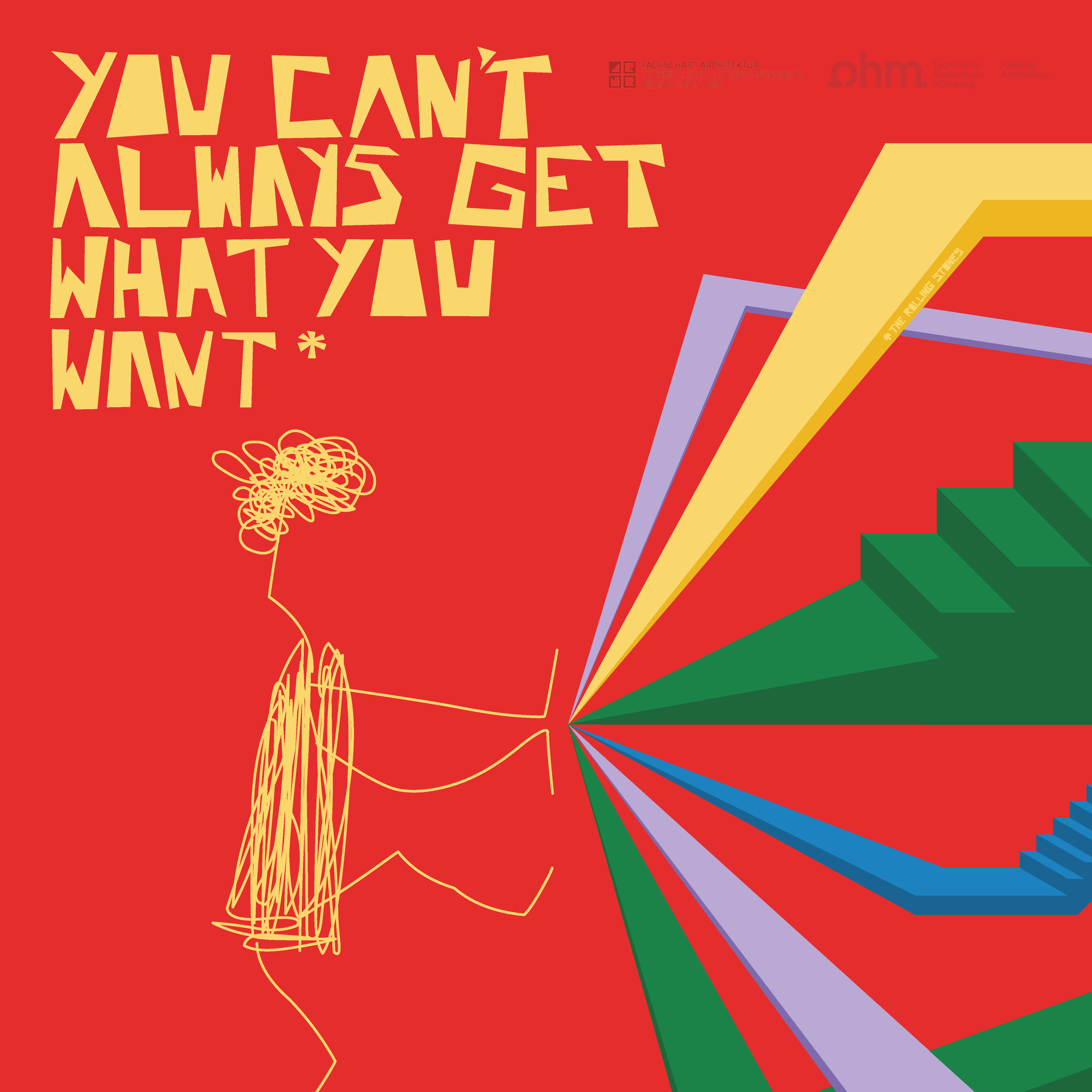Architektur ist ein Spiegel gesellschaftlicher, technologischer und ökologischer Veränderungen. Sie reagiert auf Krisen, entwickelt neue Materialien und Bauweisen und sucht nach Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit. Doch wie verändert sich unser Verständnis von Schönheit angesichts des Klimawandels, digitaler Innovationen und neuer gesellschaftlicher Bedürfnisse?
Diese Vortragsreihe widmet sich dem Spannungsfeld zwischen Beständigkeit und Wandel, Funktionalität und Ästhetik. Welche Rolle spielt Schönheit in einer zukunftsfähigen Architektur? Ist sie ein Luxus oder eine Notwendigkeit? Verändert sich unser ästhetisches Empfinden durch nachhaltige Bauweisen und wiederverwendete Materialien? Und wie lässt sich eine Architektur gestalten, die sowohl zeitgemäß als auch dauerhaft schön bleibt?
Gemeinsam mit Expert:innen aus Wissenschaft und Praxis wollen wir über die Transformation architektonischer Ästhetik diskutieren und neue Perspektiven auf die Architektur im Wandel eröffnen.
„Vom Jagen, Züchten und Ernten in der Architektur“ – unter diesem Titel gibt Prof. Dirk E. Hebel Einblick in seine Forschung zur Zukunft des Bauens.
Als Professor für Nachhaltiges Bauen und Prodekan der Fakultät Architektur am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) beschäftigt er sich mit der Entwicklung und Anwendung kreislauffähiger, nachwachsender und recycelter Baustoffe. Seine Arbeit konzentriert sich auf innovative Materialien wie Bambus, Myzel oder Abfallprodukte, die klassische Baustoffe wie Beton und Stahl ersetzen können.
Projekte wie RoofKIT – Gewinner des Solar Decathlon 2022 – oder das Wohnmodul „Urban Mining & Recycling“ im Schweizer Forschungsbau NEST zeigen, wie materialeffizientes und ressourcenschonendes Bauen schon heute umgesetzt werden kann.
Bruno Knychalla untersucht in seinem Vortrag, wie sich Architektur angesichts von Klimakrise, Ressourcenmangel und Digitalisierung neu ausrichten muss – jenseits von Bildproduktion, entkoppelter Entwurfspraxis und formalem Schönheitsideal.
Ausgehend von Defiziten in Ausbildung und Forschung plädiert er für ein vertieftes Verständnis von Material, Herstellung und systemischen Prozessen als Grundlage gestalterisch-baulicher Praxis.
Anhand der Arbeit bei additive tectonics zeigt Knychalla, wie Architektur im industriellen und forschenden Kontext neu gedacht werden kann – durch additive Fertigung, digitale Planungsketten und nachhaltige, materialorientierte Prozesse.
Im Zentrum steht die Frage, wie Architektur durch Herstellungstiefe, Prozessintelligenz und Verantwortung an gestalterischer Relevanz gewinnt – und dabei ein neues, radikal zeitgemäßes Verständnis von Schönheit entwickeln kann: als Ausdruck von Intelligenz, Relevanz und technologischer Gestaltungskraft.
Die Architektur ist im Wandel, Gewissheiten wanken, große Herausforderungen stehen im Raum und verändern den Berufsstand.
Die Auswirkungen des Klimawandels sind dabei längst spürbare und sichtbare Realität. Besonders in dichten Ballungszentren wie Städten und Metropolen stehen Gesundheit, Aufenthaltsqualität und damit das gesellschaftliche Zusammenleben zunehmend unter Druck. Gleichzeitig leben weltweit, auch in Deutschland, immer mehr Menschen in Städten. Durch die Urbanisierung wächst nicht nur die dortige Bevölkerungszahl, sondern auch der Flächenverbrauch und Versiegelungsgrad. Gleichzeitig dominiert der Individualverkehr. Eine fehlende Abkehr vom Auto in Kombination mit wachsendem Wohnraummangel und einem steigenden Pro-Kopf-Flächenbedarf führt zu einem gefährlichen Ungleichgewicht. Metropolregionen geraten dadurch unter enormen Flächendruck. Boden und Raum werden Mangelware uns somit zur Spekulationsware. Klimawandel, Migration, Globalisierung, aber auch Privatisierung, Spekulation und Gier verschärfen diese Dynamik zusätzlich.
Welche Raumstrategien können Abhilfe schaffen?
Die Konzentration auf einen geringen Flächen- und Ressourcenverbrauch ist entscheidend, genauso wie der konsequenten Erhalt und Ausbau von ökologischen und klimatischen Ausgleichsräumen. Dem Erhalt des baulichen und freiräumlichen Bestandes kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Im Bestand stecken erhebliche Raumpotentiale, die einer zusätzlichen Versiegelung und Ressourcenbindung entgegenwirken können.
Andererseits und ganz entscheidend ist aber auch die Geschichte und Identität, die der Bestand mitbringt. Damit trägt er dazu bei, dass Quartiere, Gebäude und öffentliche Räume Ausstrahlung haben, Geschichten erzählen und damit Räume erst lebendig machen. Dieser Aspekt sollte gerade im Kontext von Identitätsfragen unserer Gesellschaft nicht unterschätzt werden. Unsere gebaute Umwelt gibt uns Halt – und fordert uns heraus.
Die Konzentration auf einen geringen Flächen- und Ressourcenverbrauch ist entscheidend, genauso wie der konsequenten Erhalt und Ausbau von ökologischen und klimatischen Ausgleichsräumen. Dem Erhalt des baulichen und freiräumlichen Bestandes kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Im Bestand stecken erhebliche Raumpotentiale, die einer zusätzlichen Versiegelung und Ressourcenbindung entgegenwirken können.
Andererseits und ganz entscheidend ist aber auch die Geschichte und Identität, die der Bestand mitbringt. Damit trägt er dazu bei, dass Quartiere, Gebäude und öffentliche Räume Ausstrahlung haben, Geschichten erzählen und damit Räume erst lebendig machen. Dieser Aspekt sollte gerade im Kontext von Identitätsfragen unserer Gesellschaft nicht unterschätzt werden. Unsere gebaute Umwelt gibt uns Halt – und fordert uns heraus.
Urbane Kreisläufe - das konsequente Einbinden vom Vorhandenen für das Zukünftige - sind ein Schlüssel für eine nachhaltige und klimagerechte Raumproduktion.
Prof. Dr. Manfred Köhler ist einer der führenden Köpfe im Bereich der Gebäudebegrünung in Europa. Er lehrt an der Hochschule Neubrandenburg und beschäftigt sich seit über drei Jahrzehnten mit der ökologischen Wirkung von Dach- und Fassadenbegrünungen. Bereits in den 1980er Jahren forschte er an der TU Berlin zu diesem Thema, war später in der angewandten Landschaftsplanung in Bremen tätig und engagiert sich seither auch international, unter anderem als Mitbegründer und Präsident des World Green Infrastructure Network.
In seinem Vortrag geht Köhler der Frage nach, ob begrünte Fassaden mehr sind als nur architektonische Spielerei. Welche Rolle können sie tatsächlich bei der Abkühlung überhitzter Städte spielen? Auf Basis praktischer Erfahrungen, realisierter Projekte und aktueller Forschung zeigt er auf, welches Potenzial vertikale Begrünungssysteme für die klimaresiliente Stadtentwicklung bieten und wo ihre Grenzen liegen.